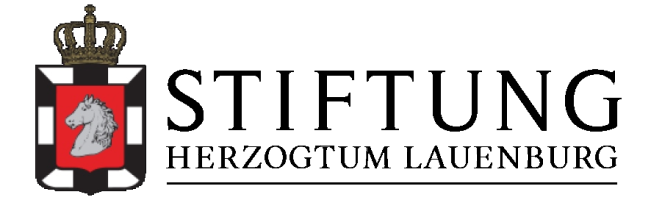Zweifel an sich selbst. Claudia Bormann hat sie lange in sich getragen. Kann ich das? Ist das, was ich mache, überhaupt gut genug? Sind andere nicht viel besser, viel talentierter als ich? Sie hat darüber gebrütet. Immerzu – über den „Mythos der Begabung“, wie sie es nennt.
Vom Weg abgebracht hat es sie nicht. Es ist ein Weg mit vielen Schritten. Mit Umwegen, auch Sackgassen. Es ist das Leben. Ihr Weg.
Den ersten Schritt macht sie in der Pubertät. Als 13-Jährige entdeckt sie die bildende Kunst für sich. Fortan rennt sie in jede Ausstellung, derer sie habhaft werden kann. Sie beginnt gegen die gesellschaftlichen Erwartungen und Moralvorstellungen zu rebellieren. Sie wendet sich gegen die Familie – gegen das Bildungsbürgerliche ihres Elternhauses. „Mir war das alles zu spießig“, sagt sie rückblickend. Heute findet sie ihr Verhalten „egozentrisch“.
Doch es sind die 70er und sie ist mit ihrem Aufbegehren ganz ein „Kind“ der Zeit. Claudia Bormann schließt sich der Hausbesetzerszene an. Wenn auch nicht an „vorderster Front“. In den deutschen Großstädten hat sich die Jugend hier ihre eigene Popkultur geschaffen, deren Soundtrack aus bundesdeutschen Fenstern dröhnt. „Ton Steine Scherben“ singen den „Rauch-Haus-Song“ oder „Keine Macht für Niemand“.
Claudia Bormann hört Pink Floyd. Aber ideell ist sie ganz bei Rio Reiser & Co. Auf keinen Fall möchte sie fremd bestimmt sein. Für sie heißt das: Sie will freie Künstlerin werden. Dafür ist sie nach Stuttgart gekommen, wo sie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste studiert. Dort ist sie unter Gleichgesinnten, was sich nicht nur als Erfüllung eines Traums entpuppt. Es ist auch ein Erwachen in der Realität. „Die Selbstzweifel künstlerischer Art, die mich ständig begleitet haben, die muss man an der Kunstakademie ganz hart erleben“, erinnert sie sich. Da treffe man auf Leute, wo man denke: „Wow, der schwimmt einem jetzt davon und macht die ganz große Karriere.“
Während einige Kommilitonen offensichtlich wissen, wohin die ästhetische Reise für sie gehen soll, sucht die junge Claudia Bormann noch nach ihrer eigenen Handschrift, ihrem eigenen Stil. Diese Suche endete auch nicht mit dem abgeschlossenen Kunststudium. Auf eine gewisse Art bleibt sie eine Unvollendete. Die wasserkinetischen Objekte, die sie für Kunst am Bau erfindet, machen sie nicht froh. Sie probiert es mit allen erdenklichen Genres und Techniken – mit Installationen, mit Collagen. Nichts davon zündet so richtig.
Mitte der 90er nimmt sie schließlich Farben und Pinsel in die Hand – ohne große Überzeugung. „Malen, hatte ich immer gedacht, kannst du nicht.“
Sie malt. Landschaftsbilder. Große Bilder, die so „realistisch wie nötig und so abstrakt wie möglich“ sind. Es ist die Entdeckung eines, ihres Stils. Die Naturbetrachtungen, denen etwas Romantisches anhaftet, schlagen ein. Hier ist sie plötzlich sie selbst und es ist ausgerechnet die Welt ihrer Kindheit, der sie einst entkommen wollte und die sich in dieser Kunst nun Bahn bricht. Die Wälder, die sie malt, sind die Wälder, die sie sah, wenn sie mit ihrem Vater in Wertheim an der Tauber durch die Natur streifte.
Der ästhetische Rückgriff ist zweifellos ein Erfolg, doch Ruhe gibt er ihr nicht. Als frei Künstlerin hat sie kein geregeltes Einkommen. Das sorgt sie. So sehr, dass ihre Arbeit darunter leidet. Claudia Bormann muss einsehen, dass die Jobbeschreibung der freien Künstlerin nicht ihrem persönlichen Profil entspricht.
Die Einsicht ist schon da, als es sie in den hohen Norden – nach Ratzeburg – zieht. Eine Kollegin ihres Mannes – sie hat einen Kunsterzieher geheiratet – schlägt ihr vor, es an der Schule zu probieren.
Claudia Bormann wird Lehrerin. Sie erhält eine Anstellung am Marion-Dönhoff-Gymnasium. Jetzt profitiert sie davon, dass ihre Ausbildung an der Kunstakademie so praxisorientiert war. Auch dass sie parallel dazu Kunst- und Literaturgeschichte an der Stuttgarter Uni studiert hat, erweist sich als nützlich.
Für Vertreter der reinen Lehre mag es paradox klingen, aber ohne Geldsorgen gelingen ihr (noch) bessere Kunstwerke. So sieht sie es, so sehen es tausende, die in ihre Ausstellungen strömen. So sehen es die Kunstliebhaber, die ihre Bilder kaufen.
Die Claudia Bormann des Jahres 2020 malt mit Leichtigkeit und Selbstbewusstsein. Manchmal gewinnt ihre Arbeit sogar etwas Tänzelndes. Die Leinwand am Boden. Farbe, die zu Strichen wird, um sich später aus der Ferne auf wundersame Weise in Flüsse, Pflanzen oder Wälder zu verwandeln. Dazwischen pendelnd die Künstlerin. Immer unterwegs. Der Pinsel wandert über das Papier. Das Gesicht der Künstlerin darüber. Mitunter skeptisch, aber immer in gespannter Erwartung.