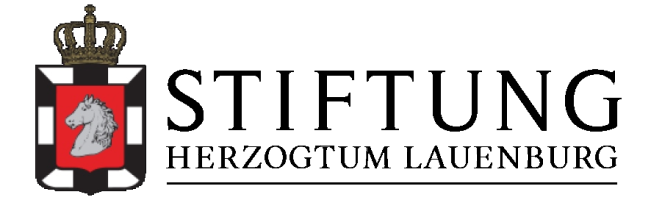Ulrich Lappenküper ist seit 2009 Geschäftsführer der Otto-von-Bismarck-Stiftung, die in Friedrichsruh ihren Hauptsitz hat. Der gebürtige Westfale ist habilitierter Historiker und ein Experte der Bismarck-Zeit. Kulturportal-Herzogtum.de sprach mit ihm über sein Aufgabenfeld, den großen Kanzler und über die Aufgabe moderner Geschichtsschreibung.
Kulturportal-Herzogtum.de: Herr Lappenküper, wie sind Sie zur Bismarck-Stiftung gekommen? Haben Sie schon immer ein besonderes Interesse an Otto von Bismarck gehabt?
Ulrich Lappenküper: Ich habe über Bismarcks Russlandpolitik der frühen 1870er Jahre promoviert. Der Betreuer der Arbeit, Prof. Dr. Klaus Hildebrand, war Fachmann für internationale Beziehungen des 19. und 20. Jahrhunderts. Durch seine Lehre erhielt ich natürlich eine gewisse Prägung. Bismarck wurde dadurch für mich zu einer wichtigen Gestalt – ich sage bewusst nicht Lichtgestalt.
KP: Wie ging es dann für Sie weiter?
Lappenküper: Ich habe habilitiert und in Bonn gelehrt. Als meine Zeit dort auslief – an den Universitäten gibt es dieses merkwürdige Konstrukt der Beamtenschaft auf Zeit – bewarb ich mich 2005 in Friedrichsruh auf die Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters.
KP: Hätten Sie nicht an der Uni bleiben können?
Lappenküper: Die Stelle in Friedrichsruh fand ich spannend, und die Otto-von-Bismarck-Stiftung war das einzige Institut, das mir eine Dauerstelle anbot. Außerdem war die Aussicht, mich mit 46 Jahren, Frau und drei Kindern mit Jahresverträgen über Wasser zu halten, nicht so erquicklich.
KP: Mittlerweile sind Sie Geschäftsführer der Stiftung…
Lappenküper: Die Dinge haben sich für mich positiv entwickelt. 2009 ergab sich die Möglichkeit, die Geschäftsführung zu übernehmen. 2012 folgte der Aufstieg in den Vorstand.
KP: Was macht man als Geschäftsführer der Bismarck-Stiftung?
Lappenküper: Als der Bundestag 1997 die Stiftung als eine Stiftung des öffentlichen Rechts gründete, hat er ihr zwei zentrale Aufgaben übertragen: Bismarck und seine Zeit zu erforschen und historisch-politische Bildungsarbeit zu leisten…
KP: Welche Rolle kommt Ihnen dabei zu?
Lappenküper: Der Geschäftsführer legt die Grundsätze, Zielsetzungen und Strategien der Stiftungsarbeit im Bereich von Forschung und historisch-politischer Bildungsarbeit fest. Ihm obliegt außerdem die Planung und Durchführung von Forschungsvorhaben sowie die korrekte Verausgabung der Bundesmittel. Unterstützt werde ich in Friedrichsruh von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter, einem Museumspädagogen, fünf Verwaltungskräften und vier studentischen Mitarbeiten. Eine weitere wissenschaftliche Mitarbeiterin leitet das von der Otto-von-Bismarck-Stiftung betreute Bismarck-Museum in Schönhausen und wird von einer Museumspädagogin unterstützt.
KP: Das klingt nicht unbedingt so, als bliebe Ihnen da noch allzu viel Zeit für die eigene Forschungsarbeit…
Lappenküper: Mit einer 40-Stunden-Woche schaffen Sie das nicht. Bei 60 Stunden sieht es anders aus. Da gelingt es Ihnen schon, auch noch eigene Forschung zu betreiben. Gerade liegt ein Buch über Bismarck und Frankreich beim Verlag. Außerdem organisiere ich Konferenzen, gebe Tagungsbände heraus und schreibe Aufsätze.
KP: An der Universität haben Sie auch unterrichtet. Wie steht es damit?
Lappenküper: Vor dem Hintergrund unserer Arbeit ist es für mich unabdingbar, dass die Stiftung Kontakt zur universitären Welt und Forschung hält. Ich bin deshalb als außerplanmäßiger Professor an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg tätig und lehre dort für zwei Trimester-Wochenstunden.
KP: Herr Lappenküper, kommen wir auf das Forschungsgebiet der Stiftung zu sprechen. Besteht nicht die Gefahr, die Bedeutung Bismarcks zu überhöhen und Dinge zu einseitig zu bewerten?
Lappenküper: Nein, das sehe ich nicht so. Als Stiftung befassen wir uns ja weiß Gott nicht nur mit Bismarck. Und persönlich interessiere ich mich vornehmlich für die Geschichte der internationalen Beziehungen im 19./20. Jahrhundert, nicht zuletzt für das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich. Ich habe auch ein Buch über François Mitterrand geschrieben und mich damit wissenschaftlich bis an die Grenze des 21. Jahrhunderts gewagt.
KP: Ausgangspunkt ist – wie Sie bereits sagten – die Bismarckzeit. Womit wir beim großen Kanzler wären: Wie bewerten Sie diesen Mann?
Lappenküper: Bismarck war ambivalent und vielschichtig in seinem Wesen. Leistungen wie die Einigung Deutschlands, die Gründung des Nationalstaats und die Sozialgesetzgebung werden heute noch zurecht positiv gesehen. Sie galten damals und auch heute noch als vorbildlich. US-Präsident Obama beispielsweise hat sich bei Obamacare auf Bismarck berufen. Auf ihn zurück geht auch die Begründung einer europäischen Friedensordnung.
KP: Sie bezeichnen Bismarck als „ambivalent“ und „vielschichtig“. Was war denn nicht so toll an ihm?
Lappenküper: Der Kampf gegen die „Reichsfeinde“, gegen die Sozialdemokratie, Katholizismus, ethnische Minderheiten. Neben allen Leistungen dürfen wir als Wissenschaftler die Fehlleistungen nicht verschweigen und müssen dabei zugleich stets den Bogen in die heutige Zeit spannen. Es geht uns nie nur um den einen Akteur in seiner Zeit. Es geht auch immer darum, was er uns heute zu sagen hat. Wo sind die Verbindungslinien in die Gegenwart? Wie können wir Lehren für die Zukunft ziehen?
KP: Das ist das Ideal. In der internationalen Politik hat man heute das Gefühl, dass diese Lehren ignoriert werden und sich mehr und mehr autoritäre Herrschaften herausbilden. Ist es da nicht nur eine Frage der Zeit, bis sich das auch in der Geschichtsschreibung widerspiegelt? Ich denke da konkret auch an einen Aufsatz, den ich in Ihrem Begleitbuch zu Ihrer Ausstellung „Geburtstag der deutschen Demokratie?“ gelesen habe“. Der Historiker Frank-Lothar Kroll* stellt da die politische Verfasstheit des Kaiserreichs als extrem positiv heraus.
Lappenküper: Was mein Kollege Kroll geschrieben hat, ist nicht falsch, m. E. aber recht einseitig. Er hat die positiven Seiten der staatlichen Verfasstheit des Kaiserreiches zu stark verabsolutiert und die negativen Seiten weitgehend ausgeblendet. Ein Beispiel: Es gab in Deutschland seit 1871 das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht und damit das modernste Wahlrecht der damaligen Zeit. Aber kann man allein aus dem Wahlrecht den Grad der Demokratie eines Gemeinwesens ableiten? Kroll unterlässt es außerdem, darauf hinzuweisen, dass in Preußen das Dreiklassenwahlrecht** galt.
KP: Wie bewerten Sie das Kaiserreich?
Lappenküper: Zunächst einmal ist festzustellen, dass es in jüngster Zeit die Tendenz in der Geschichtsschreibung gibt, die positiven Seiten des Reiches herauszuheben. Zurecht. Es war nicht der Obrigkeitsstaat, als der er lange galt. Das Kaiserreich war kulturell und wirtschaftlich hochmodern und hätte sehr wohl eine Zukunft haben können, wenn die Eliten in Politik und Militär nicht im Herbst 1918 versagt hätten. Selbst Friedrich Ebert*** beispielsweise konnte sich noch am 31. Oktober 1918 den Erhalt der Monarchie vorstellen.
KP: Herr Lappenküper, ich danke Ihnen für das Gespräch.
*Essay: „Demokratische Teilhabe im preußisch-deutschen Obrigkeitsstaat: Verfassung und Politik im späten Kaiserreich“, Frank-Lothar Kroll. Der Text ist ein Teil des Begleitbuches, das die Otto-von-Bismarck-Stiftung zur Ausstellung „Geburtstag der Demokratie“ herausgegeben hat.
**In Preußen wurden die Wähler in drei verschiedene Steuergruppen eingeteilt. Das Stimmengewicht orientierte sich an der Steuerleistung.
***Friedrich Ebert war seit 1913 Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei und amtierte von 1919 bis zu seinem Tod 1925 als Reichspräsident der Weimarer Republik.
Mehr zur Otto-von-Bismarck-Stiftung:
https://kulturportal-herzogtum.de/2018/10/29/warten-auf-die-baugenehmigung/