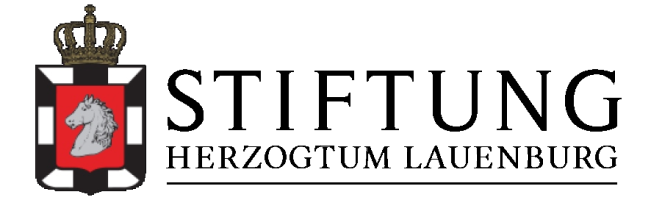Mit acht Sängerinnen und Sängern und einem achtköpfigen Orchester hat der Ratzeburger Domkantor Christian Skobowsky die „Johannes-Passion“ von Bach aufgeführt und sich dabei filmen lassen. Es war ein Projekt unter außergewöhnlichen Bedingungen: Lediglich 48 Stunden hatte das Ensemble Zeit, um diese Live-Performance im Dom einzuspielen. Auf Abstand versteht sich und mit einem aufwändigen Hygienekonzept. Kulturportal-Herzogtum.de sprach mit Skobowsky über diese besondere Arbeit.
Kulturportal-Herzogtum.de: Für die Produktion des Films hatten Sie lediglich 48 Stunden Zeit. Normalerweise wäre man da als Dirigent doch verstimmt – oder?
Christian Skobowsky: Man hat auf jeden Fall Ehrfurcht vor so einer Situation. Aber ich habe schon gewusst, dass das funktioniert. Das sind ja alles professionelle Musiker, die sich darauf vorbereitet haben. Es ist wie mit dem Radfahren. Das verlernt man auch nicht. Aber trotzdem: Wenn es eine Zeit lang nicht passiert ist, herrscht eine gewisse Spannung, ob denn auch alles ineinandergreift.
KP: Gibt es für so eine erzwungenermaßen verdichtete Zusammenarbeit eine Art Königsweg?
Skobowsky: Normalerweise stellt man sich mental ganz anders auf so eine Aufführung ein. Für eine Johannes-Passion habe ich sonst mindestens ein Vierteljahr Zeit, um mit dem Domchor zu proben. Das heißt: Ich bin gezwungen, mich ein Vierteljahr lang jeden Mittwoch auf eine Chorprobe vorzubereiten. Ich lebe dann mit diesem Werk. In diesem Fall habe ich das nicht gemacht. Man hatte zwei Wochen Zeit, sich mit diesem Werk auseinanderzusetzen und dadurch, dass ich es schon zwei-, dreimal aufgeführt habe, habe ich auch nicht bei null angefangen. Ich weiß dann schon, wo die Tücken sind und das wissen die Mitwirkenden auch. Man geht die Probleme dann zielgerichtet an. Das Spannende ist dann einfach nur, ob es auch atmosphärisch funktioniert. Weil ja jeder Mensch ein bisschen anders tickt. Die technischen Sachen – das ist klar, dass das irgendwie funktionieren muss.
KP: Sie sagten, dass Sie normalerweise mit so einem Werk leben würden. Hat sich dieses Gefühl unter diesen besonderen Umständen wieder eingestellt?
Skobowsky: Wenn Sie ein Vierteljahr kein Fleisch gegessen haben, schmeckt es natürlich besonders gut, weil sie sich die ganze Zeit darauf freuen. Ich hatte bei uns den Eindruck, dass es gerade deswegen eine so gute Aufführung wurde, weil mir bewusst war, wie kostbar das in dieser Zeit ist. Es war eine einmalige Möglichkeit.
KP: Ich wollte auf etwas anderes hinaus. Sie haben die Johannes-Passion ja schon mal aufgeführt. Die Musik ist also kein Neuland für Sie. Ich frage mich, ob man – wenn man so wenig Zeit hat – sich emotional so zügig einfindet in das Werk?
Skobowsky: Ja, ganz einfach schon, weil das Stück so grandios ist. Allein der Eingangschor – wenn man den hört – ist man sofort in dem Werk drin. Das ist die Ouvertüre. Man weiß dann genau, was jetzt kommt. Das fängt mich sofort ein.
KP: Sie haben die Bedeutung der Arbeitsatmosphäre schon angesprochen. Wie muss sie aussehen, wenn man nur 48 Stunden Zeit hat?
Skobowsky: Sie brauchen zunächst einmal unbedingtes Vertrauen in die Mitwirkenden. Bis auf zwei, drei Leute, die das erste Mal dabei waren, verbindet mich mit allen anderen eine lange Zusammenarbeit. Diese Leute wissen, wie ich ticke, und ich weiß, wie sie ticken. Da kann man dann in ganz kurzer Zeit auch an das anknüpfen, was man bereits aufgebaut hat.
KP: Das heißt: Sie haben mit einem Großteil des Ensembles schon des Öfteren zusammengespielt?
Skobowsky: Sowohl mit dem Konzertmeister als auch mit der Cellistin habe ich schon viel gemacht. Auch beide Oboistinnen waren schon öfter bei uns. Und den Organisten kenne ich eigentlich, seit er lebt. Es gibt da eine Art Netzwerk unter den Musikern. Insofern war es auch kein Problem, sie zum Ensemble zu verbinden.
KP: Und das Zusammenspiel ist dann kein Problem?
Skobowsky: Da gibt es ja eine Vorarbeit. Selbst die Jüngeren, die am Anfang ihrer Karriere stehen, sind auf der Höhe ihrer Fähigkeiten. Die jungen Leute gehen noch mal anders in die Musik rein, weil sie für sie noch so unverbraucht ist. Etwas zugespitzt könnte man sagen: Das Vokalensemble hat die Erfahrung und die Ruhe reingebracht und die Orchesterleute haben Impulse gesetzt.
KP: Dem Orchester war das Stück aber genauso vertraut wie den Sängerinnen und Sängern?
Skobowsky: Ja und nein. Orgel und Cello, die den tragenden Part übernommen haben, haben die Johannes-Passion das erste Mal gespielt. Beide haben in den 14 Tagen wahrscheinlich nichts anderes gemacht, als sich auf die Produktion vorzubereiten. Das war schon eine besondere Leistung. Aber beides sind Musiker, die bei vergleichbaren Werken schon gezeigt haben, dass sie das dann auch schaffen.
KP: Je älter die Musik ist, desto mehr Interpretationsspielraum steckt in den Noten – so heißt es. Die Johannes-Passion ist eine Barockkomposition – sie ist also sehr alt. Hat Ihnen das bei der Aufführung geholfen?
Skobowsky: Ich sehe das anders. Es ist natürlich so: Wenn man von Bach eine Partitur nimmt, steht da ein Viervierteltakt und vielleicht noch ein Tempo. Mehr nicht. Da steht weder laut noch leise oder irgendetwas anderes. Aber wenn man sich mit Barockmusik beschäftigt, dann kommt man nicht umhin, sich auch mit Quellen und Aussagen zu der Musik zu befassen. Es gibt da ganz viele Dinge, die man weiß, auch wenn sie nicht in der Partitur stehen. Es gibt also Regeln. Ich glaube deshalb, man kann aus einer Bach-Partitur genauso viel herauslesen, wie man aus einer Mahler-Partitur herausliest. Für Leute, die Barock-Musik nicht als Schwerpunkt haben, gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass man sagt: Die Musik ist so alt, ich will die nicht historisch machen, sondern ich mache das halt so, wie ich mir das denke. Die Frage ist: Will man die Johannes-Passion von Bach aufführen oder will man sich selber mit der Johannes-Passion von Bach profilieren. Da stellt sich dann immer auch die Frage nach der Werktreue.
KP: Würden Sie sich denn als „werktreu“ bezeichnen?
Skobowsky: Ich stehe weder für das eine noch für das andere. Ich stehe in der Mitte. Ich möchte mich nicht profilieren, aber ich möchte schon eine lebendige Aufführung für heutige Ohren machen.
KP: Wie sieht es denn mit der Werktreue bei Ihrer Aufführung aus?
Skobowsky: Die Chorgröße könnte so wie früher gewesen sein, allerdings war das Orchester größer. Anders als heute. Wir haben ja oft Riesenchöre heute und ein kleines Orchester. Auf jeden Fall war das Streichorchester bei Bach größer. Heute haben wir immer nur eine erste und eine zweite Violine und eine Bratsche – die waren in der Barockzeit alle mehrfach besetzt. Für unsere Aufführung habe ich auch noch die beiden Flöten weggelassen, weil die ja die meisten Aerosole verteilen. Also bei Bach wäre das Orchester ein bisschen größer gewesen. Trotzdem würde ich sagen, dass meine Aufnahme den barocken Möglichkeiten natürlich dichter kommt als eine übliche Oratorium-Aufführung mit 100 Mitwirkenden.
KP: Dem Publikum scheint die Aufführung zu gefallen. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Aktuell haben sich den Film mehr als 3.000 Menschen angesehen…
Skobowsky: Gerade im internationalen Vergleich ist das noch keine hohe Zahl, aber ich bin trotzdem sehr stolz darauf. Man erreicht schon ein paar Leute.
KP: Herr Skobowsky, ich danke Ihnen für das Gespräch.
.Die Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg ist Premiumpartner der Stiftung Herzogtum Lauenburg.