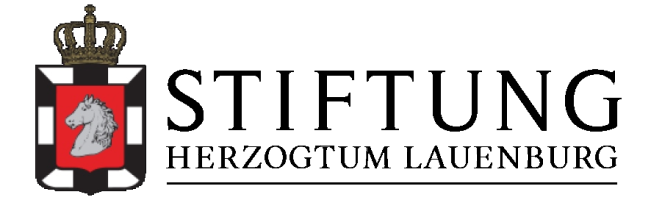Wie so viele Institutionen hat die Otto-von-Bismarck-Stiftung pandemiebedingt anstrengende Zeiten hinter sich. Und die Zukunft – wie sich im Interview von Kulturportal-Herzogtum.de mit Geschäftsführer Ulrich Lappenküper und Natalie Wohlleben, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, schnell herausstellt – dürfte nicht weniger anstrengend werden. Die Stiftung plant eine neue Dauerausstellung. Dafür hat sie kürzlich das nur einen Steinwurf von ihrem Sitz in Friedrichsruh entfernte Bismarck-Museum erworben.
Kulturportal-Herzogtum.de: Herr Lappenküper, das Bismarck-Museum gehört seit kurzem der Stiftung. Sie planen, dort eine neue Dauerausstellung zu installieren. Liegt das Konzept dafür schon in der Schublade?
Prof. Dr. Ulrich Lappenküper: Unser Ziel ist es tatsächlich, in diesem Gebäude eine neue Dauerausstellung zu installieren. Voraussetzung ist, dass das Gebäude zunächst einmal grundsaniert wird. Das wird sicherlich einige Zeit in Anspruch nehmen – sowohl was die Baumaßnahmen als auch was die Finanzierung angeht. Hintergrund ist, dass die Ausstellung hier im Hause mittlerweile 22 Jahre auf dem „Buckel“ hat. Wer sich mit Dauerausstellungen auskennt, weiß, dass sie nach spätestens 15 Jahren dringend der Modernisierung bedürfen. Wir wollen unsere aktuelle, die noch hier im Bahnhofsgebäude ist, aufheben und im Museumsgebäude mit seinen wunderschönen Exponaten dann in einer neuen Dauerausstellung über Otto von Bismarck und seine Zeit zusammenführen.
KP: Sie sagten gerade, dass das Museum vorab grundsaniert werden muss. Haben Sie schon eine Vorstellung davon, wie viel Zeit das in Anspruch nehmen wird?
Lappenküper: Das Entscheidende wird die Frage der Finanzierung sein. Alles hängt davon ab, wie rasch wir die Mittel dafür zur Verfügung gestellt bekommen. Wir sind da in Gesprächen und hoffen, dass sobald wie möglich das „Go“ aus Berlin kommt. Erst dann können wir in die Planungsphase eintreten. Natürlich haben wir schon Ideen, wie man Dinge umsetzen kann.
KP: Die weitere finanzielle Unterstützung durch den Bund ist also bloß eine Frage der Zeit…
Lappenküper: Der Kauf des Museums war ja von vornherein mit der Idee eines Kulturzentrums inklusive einer neuen, modernen Dauerausstellung verbunden. Uns geht es ja auch darum, dass man die weiteren Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Vorträge nutzen kann und die Beengtheit hier im Gebäude endlich aufhebt. Im Prinzip geht es um die Zukunftsfähigkeit der Stiftung.
KP: Wissen Sie schon, wie die Aufteilung des Gebäudes ausfallen wird?
Lappenküper: Nein. Der Umbau des Gebäudes hängt von verschiedenen Parametern ab und von der Frage, inwieweit der Denkmalschutz unsere Ideen absegnet. Da müssen noch viele Gespräche geführt werden. Eines ist aber vollkommen klar: Das Gebäude ist, so wie es da steht, für eine neue Dauerausstellung nicht geeignet. Wir müssen uns beispielsweise über Barrierefreiheit Gedanken machen.
KP: Gehen wir davon aus, dass die Sanierung des Gebäudes hoffentlich schon bald von statten geht. Wie würde dann das Museum darin aussehen? Ich nenne mit „Bestand“ und „Digitalisierung“ einfach mal zwei Stichpunkte.
Lappenküper: Der Bestand, den wir haben, ergibt sich aus den Exponaten, die uns als Eigentümer zur Verfügung stehen. Wobei es natürlich nicht unser Ziel ist, das Museum gewissermaßen 1 zu 1 zu erhalten. Es soll eine moderne Dauerausstellung mit mehr Originalobjekten sein, als es bisher hier im Hause der Fall war. Natürlich auch mit medialen Zugängen. Das Problem ist: In dem Moment, wo eine Dauerausstellung eröffnet wird, ist sie fast schon wieder veraltet. Wir müssen also gewissermaßen das Zeitfenster mit in unsere Planung einbeziehen – auch in Hinblick auf die Frage der Technisierung.
KP: Wie steht es um die inhaltliche Ausrichtung?
Lappenküper: Die Themenstrukturen sind für uns gewissermaßen vorgegeben. Der Ausstellungstitel lautet ja „Otto von Bismarck und seine Zeit“. In den vergangenen Jahren haben sich da natürlich weitere Themen, die wir hier bisher nur am Rande behandelt haben, in den Mittelpunkt geschoben. Das gilt zum Beispiel für die Kolonialpolitik.
KP: Denken Sie auch darüber nach, Exponate zusätzlich zum Bestand zu erwerben?
Lappenküper: Wenn sowohl der Magazinbestand als auch der Bestand im Museum selbst unseren Überlegungen nicht entspricht, werden wir gegebenenfalls einzelne – wenige – Exponate ankaufen. Aber das sind Fragen, die wir erst in dem Moment klären können, wenn wir die Raumfrage geklärt haben.
Natalie Wohlleben: Grundsätzlich haben wir mit dem Museum und mit dem Archiv wirklich einen sehr reichhaltigen Fundus, aus dem wir schöpfen können.
KP: Andererseits eröffnet sich hinter der Überschrift „Otto von Bismarck und seine Zeit“ ein extrem weites Feld. Da kann es ja bei einer Neukonzeption durchaus mal an einer Illustrationsmöglichkeit fehlen…
Lappenküper: Wenn ich von „Otto von Bismarck und seine Zeit“ spreche, geht es im Prinzip um 200 Jahre. Es geht dabei auch um die Frage des Mythos, der sich um Bismarck gebildet hat, und die Frage, wie wir damit heute umgehen. Das wird sicherlich weit intensiver zu behandeln sein, als es bisher der Fall gewesen ist. Da besitzen wir tatsächlich auch das eine oder andere Exponat.
KP: Wie muss eine moderne Ausstellung über „Otto von Bismarck und seine Zeit“ ausgestattet und konzipiert sein?
Lappenküper: Da muss man einfach auch ein Stück weit Prophetie an den Tag legen und mit einplanen, in welche Richtung es in Zukunft gehen könnte – sowohl inhaltlicher Art als auch in der Art des Zugangs. In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich ja durchaus Revolutionäres entwickelt. Heutzutage geht man häufig von der Erzählung einer Geschichte ab und versucht bestimmte Aspekte in den Mittelpunkt zu rücken. Darüber werden wir uns Gedanken machen müssen, ob das für uns der Weg sein kann. Ich bin offen gestanden skeptisch. Dieser neue Zugang wird auch schon wieder hinterfragt, weil er Defizite aufgewiesen hat. Wir als Otto-von-Bismarck-Stiftung haben nicht die Möglichkeit wie manch anderes Haus, Fehler nach drei, vier Jahren aufzufangen. Unsere Ausstellung wird einige Jahre, ja Jahrzehnte halten müssen.
KP: Und die Technik – welche Rolle kann sie, soll sie unter dieser Bedingung spielen?
Lappenküper: Wir werden auch da ganz gewiss dem aktuellen Stand der Museumspädagogik entsprechen müssen. Aber auch da neige ich zur Vorsicht. Man sieht hier und da im Land durchaus eine Übertechnisierung von Museen, mit zum Teil sehr anfälligen Ausstattungen.
KP: Herr Lappenküper, Sie sagten gerade, dass in den Museen heute nicht mehr die Erzählung einer Geschichte präsentiert werde. Sebastian Barsch, Professor für Geschichtsdidaktik in Kiel, meint, die Zeit der reinen Faktenvermittlung sei vorbei. Wie kann man dann überhaupt noch Geschichte im Museum erzählen?
Lappenküper: Die Zeit der reinen Fakten-Aufzählung ist vorbei, ja, aber die Frage ist doch, wie man erzählt. – Eine Geschichte bedarf einer gewissen Chronologie, nur darf es nicht im Sinne des 19. Jahrhunderts das Aneinanderreihen von Daten sein. Das ist vollkommen klar. Ob aber der vor 20 Jahren in der Museumspädagogik beschrittene Weg, Geschichte nur noch auf wenige Fakten zu reduzieren, zukunftsweisend war, da habe ich meine Zweifel. Das werden wir hier in einem größeren Kreis noch diskutieren müssen. Natürlich besteht immer auch die Möglichkeit, durch verschiedene Ebenen, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind – eben durch Technik – Lücken zu füllen. Trotzdem muss man sich immer fragen, wen wollen wir mit unserer Ausstellung ansprechen? Was erwartet unser heutiges und unser zukünftiges Publikum? Ich bin mir sicher, dass wir im Laufe der für uns zur Verfügung stehenden Zeit einen Weg finden werden.
KP: Ein größerer Kreis heißt, dass Sie auch Expertise von außen heranziehen werden?
Lappenküper: Auf jeden Fall. Wir haben natürlich unsere Expertise. Ich glaube, es gibt in der Bundesrepublik nur wenige, die sich so gut mit Bismarck und seiner Zeit auskennen. Aber das Wissen ist das eine, es zu vermitteln, das andere. Und dann auch noch über das Museale – da gibt es einfach die Notwendigkeit für uns, Expertise von außen mindestens einzubinden und verschiedene Zugänge kennen zu lernen. Am Ende werden wir dann eine Entscheidung treffen, bei der wir alle Gremien der Stiftung und natürlich die Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort einbeziehen werden.
KP: Birgt so ein Prozess nicht die Gefahr, dass es ein Zuviel an Ansätzen und Ideen gibt?
Wohlleben: Wir haben schon unsere wichtigen Ankerpunkte. Wir haben ein allgemeines Publikum, das aus dem In- und Ausland zu uns kommt. Außerdem sind wir wichtig für die politische Bildung. Man darf nicht vergessen, dass das hier ein außerschulischer Lernort ist. Allein unsere letzte Sonderausstellung haben 70 Gruppen besucht.
KP: Wie kann dieses außerschulische Lernen in Zeiten von TikTok und Instagram weiterhin gelingen?
Wohlleben: Ich denke – Herr Lappenküper hat das schon angedeutet –, dass wir über mehrere Ebenen rangehen müssen, damit jeder Besucher auf seine Art glücklich wird. Man kann den klassischen Museumsbesucher bedienen, der durch die Räume schlendert. Und wer Lust hat, sich die Dinge genauer durchzusehen, für den gibt es heute Apps. Aber wie gesagt: Unser Stichwort ist die politische Bildung.
Lappenküper: Was jetzt nicht heißt, dass man nicht doch möglicherweise hier und da ein inszenatorisches Element einbringt. Eins ist aber vollkommen klar: Wir werden hier keinen Eventcharakter haben. Auch wenn wir immer bemüht sein müssen, ein sehr breites Publikum zu erreichen. Die Schulklassen sind da ein Thema, ein anderes ist die Mehrsprachigkeit und die Art und Weise, wie die deutsche Sprache präsentiert wird – Stichwort „einfache Sprache“. Sie sehen also, wir stehen vor einer Menge an Überlegungen und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Ich denke aber, dass ist eine fantastische Aufgabe, sobald man uns dann endlich lässt.
KP: Herr Lappenküper – Frau Wohlleben, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Die Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg ist Premiumpartner der Stiftung Herzogtum Lauenburg.