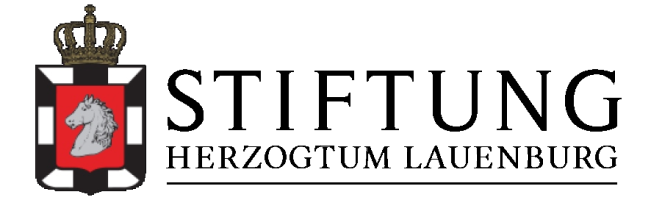Mit Hermine ist nicht gut Kirschen essen. Man sieht es an ihrem stampfenden Schritt, in dem Wut und Entschlossenheit liegen. „Sie!“ ruft Hermine (Katja Klein). „Sie!“ Das Publikum, das sich im Garten von Ernst Barlachs Vaterhaus – dem heutigen Ernst Barlach Museum Ratzeburg – versammelt hat, fährt zusammen. Glücklicherweise kann selbst der größte Drachen hin und wieder fremde Hilfe gebrauchen. Nachdem sie einen der Zuschauer dazu verdonnert hat, beim Zurechtrücken der Tische mit anzupacken, lenkt sie ihren Zorn auf jene, die ihn sich tagtäglich verdienen: den jungen Barlach und seine Brüder (Jussi Gärtner, Finbar Böge und Matas Joniskis).
Mit Hermine ist nicht gut Kirschen essen. Man sieht es an ihrem stampfenden Schritt, in dem Wut und Entschlossenheit liegen. „Sie!“ ruft Hermine (Katja Klein). „Sie!“ Das Publikum, das sich im Garten von Ernst Barlachs Vaterhaus – dem heutigen Ernst Barlach Museum Ratzeburg – versammelt hat, fährt zusammen. Glücklicherweise kann selbst der größte Drachen hin und wieder fremde Hilfe gebrauchen. Nachdem sie einen der Zuschauer dazu verdonnert hat, beim Zurechtrücken der Tische mit anzupacken, lenkt sie ihren Zorn auf jene, die ihn sich tagtäglich verdienen: den jungen Barlach und seine Brüder (Jussi Gärtner, Finbar Böge und Matas Joniskis).
Die wütende Hermine, das ist der Knall der Peitsche, der imaginäre Startschuss, mit dem Frank Düwels Theaterspaziergang „Ernst Barlach… als ich Indianer war“ Fahrt aufnimmt. Vom Garten des Hauses geht es hinein in das Vaterhaus – ins Esszimmer, in die Küche, ins Schlafzimmer. Das Publikum wandelt auf den Pfaden des jungen Barlach. Dabei inszeniert Düwel die Abenteuer des Künstlers als eine Begegnung mit sich selbst. Hier der alte Barlach (Wolfgang Häntsch), der mal rauchend, mal kommentierend, mal aus dem „Lederstrumpf“ zitierend immer im Zentrum des Geschehens steht. Da der junge Barlach, der mit seinen Brüdern durch das Haus schleicht. Bewaffnet mit Speer und Tomahawk, mit Pfeil und Bogen immer gewahr, dass die Welt da draußen eine dunkle Unbekannte ist, die Gefahr und Glück verheißt.
Klatsch. Die Ohrfeige Hermines – der „hart geräucherten Jungfrau“, wie der alte Barlach sie nennt – hat gesessen. Was lehrt das den jungen Barlach? Wer nicht rechtzeitig wegrennt, den bestraft das Leben? Nein, die Ohrfeige ist ein Windhauch, ein Nichts, gegen die Willkür des Schulrats, der die ganze Klasse grundlos mit Stockschlägen überzieht. Und wenn dieser schmerzhafte Unterricht zu Ende ist, liegen irgendwo draußen die Stadtschüler auf der Lauer, die Gymnasiasten per se nicht ausstehen können. Da ist es hilfreich, ein Indianer zu sein. Zu wissen, wie man seine Spuren verwischt. Der alte Barlach zitiert es aus dem Lederstrumpf*, aber die Wildnis, die da aufscheint, ist auch die Wildnis Ratzeburgs, die unfassbar schön ist – trotz all der Gefahren, die von ihr ausgehen.
Wildes Leben erzeugt wilde Gefühle. Es reißt den jungen Barlach mit sich fort, so wie es die Mohikaner durch die Stromschnellen jagt. Der alte Barlach blickt auf diesen blonden Jungen. So lange ist das her. Das Buch in der Hand, zeigt er sich abgeklärt. Für das Schicksal findet er abstrakte Worte. Die Rede ist vom „Selbstverständlichen des Unwahrscheinlichen“.
Selbstverständlich ist, dass die Arzttasche des Vaters stets bereitliegt und er nachts zu Krankenbesuchen aufbricht. Unwahrscheinlich ist, dass ein Junge an Diphterie stirbt. Doch der junge Barlach muss feststellen, dass es passieren kann.
„Kommt Vater wieder? Immer?“ will der junge Barlach von seinen Brüdern wissen. „Immer“, antworten sie. So wie es stets war, muss es auch künftig sein. Doch das Selbstverständliche ist nicht, dass der Vater immer wiederkommt. Das Selbstverständliche ist der Tod, das Unwahrscheinliche ist lediglich, wann es passiert. Ernst Barlachs Vater stirbt 1884. Es bedeutet auch das jähe Ende seiner Ratzeburger Indianerzeit.
Immerhin ist da schon die Saat für das künstlerische Schaffen gelegt. Er schreibt, er zeichnet, er knetet. Er versucht den Emotionen, die in ihm lodern, eine Form zu geben. Plötzlich sitzen in Düwels Inszenierung drei junge Barlachs im Garten. Versunken in ihre Arbeit sind sie dabei – um es mit den Worten des alten Barlach zu sagen – „es auf den Taugenichts anzulegen“. „Die Lebenswerkstatt“ hat ihn so entwickelt, dass er das, was er in diesem Augenblick tut, künftig „mit der Gläubigkeit einer Pflanze“ fortführen wird.
Von der Lebenswerkstatt profitiert hat auch Hermine. Dank der Barlach-Brüder weiß sie, dass Jungen nur Unfug im Kopf haben und Bediensteten immer auf die Finger gesehen werden muss. Andernfalls machen sie ihren Job nicht oder nicht richtig. So wie die Köksch, die heute zu viel Kuchen gebacken hat, den Hermine jetzt in einem Anfall von Großzügigkeit munter verteilt. Kuchen statt Ohrfeigen – damit lässt es sich als Zuschauer gut leben.
* „Lederstrumpf“ – Romanzyklus aus der Feder des US-Autoren James F. Cooper
Fotos: Antje Berodt
Text: Helge Berlinke