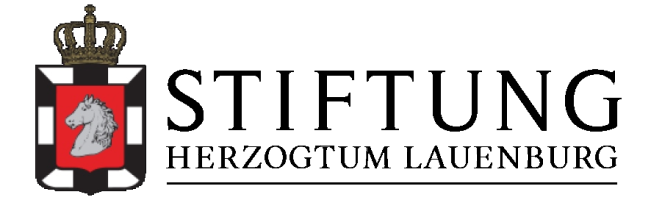Was ist weiter weg: Sakollnow oder Syrien? – Für meine siebenjährige Mutter (*1939) war der Weg ein knappes halbes Jahr nach dem Ende des 2. Weltkriegs jedenfalls sehr weit. Mit meiner Oma und ihrem jüngeren Bruder (*1944) machte sie sich von Sakollnow (Landkreis Flatow: 1818-1945 Preußen; 1938-1945 Provinz Pommern) auf nach Schleswig-Holstein: Ohne Wagen, Pferd, Fahrrad oder sonst ein Transportmittel zogen sie zusammen mit vielen anderen Kindern, Frauen und einigen wenigen kriegsverletzten Männern, aus der Heimat vertrieben – der Vater schon 1944 in Rumänien gefallen – zu Fuß nach Westen. Unterwegs fürchterliche Massaker. Meine Oma hat alles aufgeschrieben, grausame Schilderungen: wahllose Erschießungen, Vergewaltigungen der Frauen und Mädchen und Plünderungen. Meine Mutter und ihr kleiner Bruder konnten sich immer gerade noch rechtzeitig in irgendeinem dunklen Schuppen oder hinter einem Gebüsch verstecken, nur so haben sie überlebt. Am Ende wäre sie in einem Lager bei Stettin fast an einer durch Hunger-Typhus verursachten Lungenentzündung gestorben, doch ein Transport brachte sie in ein Lager nach Segeberg und dann begann die harte Nachkriegszeit als Flüchtling in Schleswig-Holstein.
Am Ende einer Flucht, die zwischen einigen Tagen bis zu einigen Jahren dauern kann, besitzen viele so gut wie nichts mehr. Vielleicht eine kleine Tasche, einen Rucksack, ein kleines Bündel. Geflüchtete sind nackt. Alles geht von vorne los – ein neues Leben, gebaut auf einer Grundlage von Erschöpfung und Schrecken, Verzweiflung und Fassungslosigkeit und manchmal einem kleinen Funken Hoffnung. Hinter sich gelassen haben Geflüchtete verschollene oder getötete Angehörige, Kinder ihre Väter, Eltern ihre Kinder und eine Heimat, die es so nicht mehr gibt. Was bleibt sind Bilder im Kopf, die ganze Räume füllen und Geschichten, die erzählt werden wollen. Damals wie heute. In welcher Form auch immer.
1946 verzeichnete Schleswig-Holstein durch die Neubürger*innen aus den Ostgebieten einen Bevölkerungszuwachs von 67 Prozent, in den letzten zehn Jahren von nur etwas mehr als zwei Prozent. Heute höre ich hier die Geschichte von Imany* aus Eritrea, 20 Jahre alt, die von ihrem Mann vor zwei Jahren hochschwanger zurückgelassen wurde. Er musste über Nacht vor dem Militär fliehen, sonst wäre er verhaftet und getötet worden. Sie konnten sich nicht einmal richtig verabschieden. Bis nach Italien schaffte er es zunächst, dann ging es für ihn nicht mehr weiter. Also machte auch sie sich auf den Weg, um ihn wiederzusehen. Nach über einem Jahr haben sie und ihre Tochter es über verschiedene Etappen zu uns in den Kreis geschafft. Über das, was ihr während der Flucht passiert ist, mag Imany nicht reden. Und ich höre die Geschichte von Bassam*, gerade mal 16, der sich mit seinem jüngeren Bruder allein auf den Weg machen musste. Von seiner Heimat bei Aleppo ist nichts mehr übrig. Nach dem Tod der Eltern und der kleinen Schwester gibt es nichts mehr, was die Brüder im Kriegsgebiet hält. Es gibt nur noch sie beide. Ein Freund hat es bis nach Mölln geschafft, da wollten sie dann auch hin, weil es hier keinen Krieg gibt. Und jetzt sind beide hier, in unserer Nähe und erzählen eine ähnliche Geschichte, wie meine Mutter oder meine Oma. Damals.
Krieg ist immer Krieg, eine Flucht ist immer weit. Die Entfernung lässt sich nicht in Kilometern messen. Sie hängt ab von der Ausgangssituation zu Beginn und am Ende der Flucht, wenn sie denn überhaupt ein Ende hat. Und es gibt immer etwas, das man vermisst, wenn man seine Heimat verlässt: Einen bestimmten Ort, geliebte Menschen, Musik, ein besonderes Essen. Ich vermisse heute manchmal die karge „Kriegsküche“ meiner Oma: Brennnessel- und Brotsuppe, Prasun und Löwenzahn- und Sauerampfersalat – das ist für mich bis heute der Geschmack der Flucht, mitten in Schleswig-Holstein, genauso wie Mhalayeh (Syrischer Milchpudding) oder Injera (eritreisches Fladenbrot) heute auch zu diesem Geschmack gehören.
Und alles gleichzeitig bedeutende Erinnerungen daran, dass Flucht – egal von woher, egal wohin – für die Flüchtenden immer ein unvorstellbar weiter, kaum zu bewältigender Weg ist. Meine Aufgabe ist es heute, diesen Weg hier ein Stück weit zu begleiten und dadurch etwas erträglicher zu machen.
Uta Röpcke
* Die Namen der Personen sind frei gewählt. Die Fluchtgeschichten der beiden einigen, die mir im Rahmen meiner hauptamtlichen Tätigkeit mit Geflüchteten begegnet sind, nachempfunden.
Der Essay ist ein Beitrag zum Projekt „Fliehen – einst geflohen“. Weitere Texte, Veranstaltungen und Ausstellungen finden Sie hier: